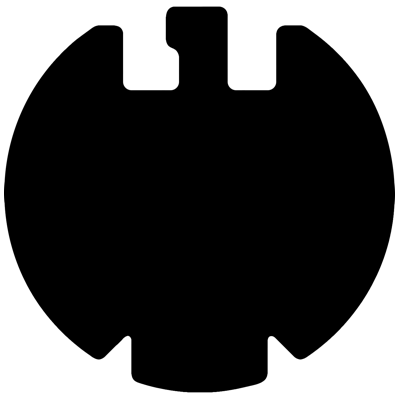Tabu, Trauer und Design – Bachelorarbeit von Max von Elverfeldt

Foto: Auszug aus der Bachelorarbeit. Sammeln der Tränenflüssigkeit zur Bewertung der Trauer im gesellschaftlichen Rahmen
Trauer und Design haben auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun, könnte man meinen. Das habe ich zumindest bisher auch gedacht. Aber dann fiel mir die Bachelorarbeit von Max von Elverfeldt in die Hände, der sich diesem Thema im Rahmen seines Interaction Design Studiums gewidmet hat. Und die lieferte sehr viele Ansatzpunkte, dass es sehr wohl gemeinsame Anknüpfungspunkte gibt.
Es klingt zunächst so, als passt es nicht zusammen, aber du hast dem Thema »Tabu, Trauer und Design« deine Bachelorarbeit gewidmet. Was haben diese drei Themen dennoch miteinander zu tun?
Der Titel ist tatsächlich etwas ungewöhnlich. Dabei muss ich zugeben, dass er erst ganz am Ende der Arbeit entstanden ist und vielmehr den Prozess beschreibt, in dem ich mich dem Thema genähert habe. Für mich stand am Anfang nur fest, dass ich mich dem Thema Tod und vor allem der Trauer experimentell nähern möchte. In vielen Gesprächen kam dann gerade im Bezug auf den Tod der Begriff des Tabuthemas ins Spiel, so dass ich zwischendurch gedacht habe, wenn ich dieses Tabu brechen kann, habe ich schon eine Lösung gefunden. So einfach ist das natürlich nicht.
Michel Friedmann hat zu diesem Thema eine sehr treffende Aussage gemacht. »Wer sich profilieren will, erfindet zuerst ein Tabu, um dann mit Lust dagegen zu verstoßen.« Und tatsächlich gibt es gerade unter Soziologen eine rege Diskussion darüber, ob der Tod noch immer so sehr tabuisiert ist wie etwa vor dreißig Jahren. Pauschal kann man das gar nicht beantworten. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Gleichzeitig ist der Tod ein Mysterium, dass die Menschheit seit tausenden von Jahren beschäftigt. Da gibt es ohne Zweifel nicht die eine Lösung.
Insofern bin ich dem Thema mit meinen Werkzeugen als Designer begegnet und habe untersucht, wo sich überhaupt Anknüpfungspunkte finden. Erst aus diesem Blickwinkel sind die angepassten Methoden und zahlreichen, kleinen Ideen entstanden. Alles in allem sind das vor allem Möglichkeiten, weshalb das Thema in der Formulierung auch erst durch den Untertitel komplettiert wird – Möglichkeiten.
Wie hat sich der Umgang mit dem Tod im Laufe der Jahrhunderte verändert? Warum gelten Tod und Trauer heute als Tabu?
In den letzten zweihundert Jahren ist der Tod buchstäblich in weite Ferne gerückt. Und das in zweierlei Hinsicht: Zum einen ist unsere durchschnittliche Lebenserwartung drastisch gestiegen und zum anderen hat sich der Sterbeort zunehmend aus den Familien in die Krankenhäuser verlagert.
Im Gegensatz zu heute lag die Lebenserwartung in Deutschland bis vor zweihundert Jahren bei annähernd vierzig Jahren. Das hatte natürlich die Folge, dass die Menschen nicht nur häufiger mit dem Tod konfrontiert wurden sondern auch früher und unmittelbarer. Denn gestorben wurde hauptsächlich zuhause. Der Tod war, wenn man das überspitzt ausdrücken will, etwas alltägliches.
Mit der industriellen Revolution Mitte des Neunzehnten Jahrhundert begann dann eine Tendenz, die bis heute nicht geendet hat. Denn die Lebenserwartung verschiebt sich seitdem kontinuierlich nach hinten und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Von einer Alltäglichkeit des Todes kann also nicht mehr die Rede sein. Denn nicht nur die Lebenserwartung hat sich verändert, sondern mit ihr auch der Zeitpunkt, an dem wir das erste Mal direkt mit dem Tod konfrontiert werden.
Gleichzeitig ist der Tod unsichtbarer geworden. Natürlich vor allem, weil sich der Sterbeort in vielen Fällen ins Krankenhaus verlagert hat, aber auch dahingehend, dass viele Bräuche und Riten, die den Tod und vor allem die Trauer in die Öffentlichkeit getragen haben, auf der Strecke geblieben sind. Ein Großteil der Krankenhäuser waren lange damit überfordert, dieser neuen Situation gerecht zu werden. Bis in die Siebziger Jahre hört man dann ganz haarsträubende Geschichten, in denen die Sterbenden in den Krankenhäusern in die Abstellkammer geschoben wurden.
Darüber, ob der Tod noch ein Tabu ist, gibt es wie gesagt verschiedene Ansichten. Das Taz-Journal hat vor fünf Jahren eine großartiges Magazin herausgegeben. ›Endlich – Der Tod ist kein Tabu mehr‹. Das stimmt so natürlich auch nicht, aber ich denke der eigentliche Zenith ist überschritten. Einen ganz großen Anteil hat da sicher die Hospizbewegung, die seit den 80er Jahren beweist, dass ein anderer Umgang mit Tod und Trauer möglich ist. Sicher muss da noch viel geschehen, aber für mich zeugt das von einem Umdenken. Der Tod wird bestimmt nie zum Komfortthema avancieren, aber die Bereitschaft sich überhaupt mit ihm auseinanderzusetzen, ist größer geworden. Das spiegelt sich auch in den Medien wieder. Zuletzt in Andreas Dreßen’s ›Halt auf freier Strecke‹. Vor zwanzig, dreißig Jahren wäre solch ein Film undenkbar gewesen.
Du hast in Gesprächen herausgefunden, dass Trauer und die Erwartungshaltung daran sich sehr unterscheiden. Offenbar gibt es Meinungen darüber wie lange Trauer dauern darf bzw. muss. Welche »Probleme« im Umgang mit Trauer hast du heraus gefunden? Was ist deine persönliche Meinung dazu?
Diese Art von Erwartungshaltung ist eines jener »Probleme«. Genau genommen richtet sich die Erwartung in zwei Richtungen. Auf der einen Seite verlangen viele Menschen von Betroffenen erst einmal ein gewisses Maß an Trauer, die nach außen sichtbar ist. Denn viele denken, nur wer sichtbar getrauert hat, kann erfolgreich bewältigt haben. Für die, die den Anspruch stellen, entschärft das vor allem die Gefahr, dass da später noch was kommt. Dass der Tod nach drei Jahren schwerer Krebserkrankung vor allem für die Nahestehenden manchmal Erleichterung bedeuten kann, dass da schon Abschied genommen werden konnte, dass da vielleicht auch eine Zeit der Leere folgen kann, vergessen viele.
Ausgeprägter zeigt sich allerdings die Erwartungshaltung an das Ende der Trauerphase. Das war auch etwas, das in beinahe jedem Gespräch mit Hinterbliebenen aufkam. Verständlicherweise trifft es viele Betroffene einfach vor den Kopf, wenn sie ohne viel Umschweife gesagt bekommen, dass das jetzt zulange dauere oder dass sie sich doch bitte professionelle Hilfe suchen möchten. In einigen wenigen Fällen ist das sicher ratsam, aber häufig trauert derjenige lediglich für die Begriffe der außenstehenden Person zu lange und bleibt mit dem Gefühl zurück irgendetwas sei nicht richtig. Am Ende dürfen wir nicht vergessen, dass Trauer wie jedes Gefühl individuell ist. Da gibt es kein richtig oder falsch. Und wenn jemand nach sechs Monaten immer noch um den Partner trauert, hemmt das vielleicht die Stimmung beim Kegelabend, aber befindet sich ganz sicher im Rahmen.
Viele solcher »Probleme« sind für mich ganz natürlich gewachsen. Die Frage ist auch, woher sollen die Menschen das wissen. Das ist in gewisser Form immer eine Ausnahmesituation und da bleibt es schwer einzuschätzen, was richtig oder falsch ist. Wenn etwa einer ausspricht, dass ihm das zu lange dauert, macht der das bestimmt nicht aus Boshaftigkeit. Im Gegenteil, das zeugt auch von dem Wunsch, dass es dem Trauernden besser gehen möge.
Gleichzeitig sollten wir nicht vergessen, dass Vertrösten nicht dasselbe ist wie Trostspenden und dieses Trostspenden auch kein Tauschhandel. Und das schließt eben ein, dass es kein unmittelbares Erfolgserlebnis oder die sofortige Auflösung der Trauer als Reaktion gibt.
Um das Tabu zu brechen, hast du im Rahmen der Arbeit versucht, Menschen ihren eigenen Tod anhand realer Zahlen vor Augen zu halten. Wie war die Reaktion darauf?
Überraschend positiv. Den Gedanken für vier Tage immer wieder mit der eigenen, runterzählenden »Restlebenszeit« – also der Zeit bis zum Erreichen der durchschnittlichen Lebensdauer – konfrontiert zu werden, war für viele Menschen im ersten Moment selbstverständlich erschreckend.
Gleichzeitig waren vor allem junge Menschen bereit, jeden Tag mehrmals auf die von mir gebaute Uhr zu schauen und die Auseinandersetzung zu suchen. Viele haben sogar erwartet, dass sie beginnen ihr Leben mehr zu nutzen, sobald sie diese Uhr bei sich aufstellen.
Im Endeffekt hat sich für alle, egal ob jung oder alt, kaum etwas verändert. Ich würde sogar behaupten, sie hätten die Anzeige vergessen, wenn ich sie nicht jeden Tag mit kleinen Aufgaben immer wieder darauf gestoßen hätte.
Besonders krass hat sich das bei einer Probandin gezeigt. Bei ihr hatte die Uhr durch einen Programmierfehler immer wieder den selben Tag angezeigt. Da stand dann am ersten Abend 52 Jahre, 8 Monate, 13 Tage, 5 Minuten und 25 Sekunden. Bis zum vierten Tag hatten sich Tage, Monate und Jahre einfach nicht verändert und obwohl sie jeden Tag die Zeit zwei Mal laut sprechend mit einer Kamera dokumentiert hat, ist ihr das gar nicht aufgefallen. Das hat sie fast mehr überrascht als mich. Ich denke, um Vergänglichkeit wirklich zu begreifen, brauchen wir größere Abstände, mit denen Zeit fühlbar wird und die wir dann auf die Zukunft anwenden können. Jeder kennt das. Silvester ist so ein Beispiel. Oder eben ein runder Geburtstag.
Im Endeffekt war die Uhr für mich weniger ein Tabubruch als vielmehr eine Art Cultural Probe. Denn das wichtigste waren die Gespräche am Ende der vier Tage. Wenn jemand über einen längeren Zeitraum immer wieder angeregt wird, über den eigenen Tod oder wenigstens das Thema nachzudenken, können ganz andere Gedanken reifen.

Wie hat sich Trauer in digitalen Zeiten verändert? Kann Trauer im digitalen Raum stattfinden und vielleicht »reale« Trauer ersetzen?
Das ist schwer zu beantworten. Egal ob in der ›digitalen‹ Welt oder nicht, das Gefühl des Verlustes bleibt für den Hinterbliebenen im Endeffekt dasselbe. Was sich aber verändert hat, ist die Art wie wir Trauer ausleben. Viele Bräuche und Riten haben im Laufe der Zeit an Bedeutung verloren. Wie oft sieht man heute noch Menschen über einen längeren Zeitraum schwarz tragen? Und wer erkennt diesen Code noch als das ›Tragen von Trauer‹? Gleichzeitig sind durch das Internet ganz neue Aspekte hinzugekommen. Häufig kann man beobachten, dass Seiten in sozialen Netzwerken von Freunden und Angehörigen zu Gedenkorten transformiert werden, wenn ein Nutzer verstirbt. Dort werden dann Erinnerungen ausgetauscht und Nachrichten, an den Verstorbenen adressiert. Für viele Menschen ist das unheimlich wichtig und unterstützt sie darin den Verlust zu verarbeiten. In gewisser Form gibt es da durchaus Ähnlichkeiten mit dem Friedhofsbesuch.
Die Frage ist, wo das ganze an seine Grenzen stößt. Etwa beim Trösten, wo nonverbale Gesten eine viel größere Rolle spielen. Da ist manchmal auch Schweigen und körperliche Präsenz das Wohltuendste. Eine Bestatterin, mit der ich ein Interview geführt hatte, hat das Dilemma gut auf den Punkt gebracht: »Über Skype kann ich kein Taschentuch reichen.«
Insofern denke ich nicht, dass der digitale Raum etwas ersetzen kann, sondern nur eine stetig wachsende Ergänzung darstellt. Und das mit allen Vor- und Nachteilen. Im Endeffekt muss ich trotzdem selber abwägen, ob es reicht eine Facebook Nachricht zu schreiben, zwei Stunden zu telefonieren oder ich mich doch in den Zug setze und der Person persönlich beistehe.
Der Tod findet in unserem Alltag so gut wie gar nicht statt. Kinder z.B. kommen mit dem Tod nur in »Ernstfällen« in Berührung. Um das zu ändern hast du ein Bestatterset für Kinder entworfen. Beschreib es etwas näher. Wie waren die Reaktionen von Kindern und Eltern drauf?
Das Bestatterset war für mich vor allem eine Provokation, die zum Nachdenken anregen soll. Denn während wir unsere Kinder auf alle denkbaren Situationen vorbereiten, wird die Möglichkeit, dass jemand verstirbt von Eltern häufig solange ausgeklammert, bis der Fall tatsächlich eintrifft. Dabei ist der Tod einer der wenigen Dinge im Leben, mit denen sich jeder an irgendeinem Punkt auseinandersetzen muss.
Spannend ist, wie wir Kindern andere Lebenswirklichkeiten vermitteln. Jedes Kind hat einen Arztkoffer und kann so spielend den Arzt imitieren. Wir spielen Einkaufen mit den Miniaturen echter Produkte und in der so beliebten Kinderpost kann ich heute mein Prepaidhandy imaginär aufladen. Das ganze geht so weit, dass Vierjährige Puppen haben, die ich nicht nur füttern kann, sondern die auch in die Windel machen. Alles Situationen, denen Kinder später einmal begegnen können. Manchen mehr, manchen weniger. Aber eine, der jeder begegnet, wurde da bisher komplett ausgelassen.
Insofern soll das Bestatterset vor allem die Frage aufwerfen, warum das so ist. Dabei habe ich versucht die gängigsten Elemente unserer Trauerkultur im Stile eines solchen Spielzeugs nachzuahmen. Das heißt es gibt einen Sarg aus Pappe und einen Grabstein, der in einem gewissen Rahmen gestaltet werden kann. Mit kleinen Stempeln lassen sich beigelegte Karten mit gängigen Motiven wie etwa der Rose oder einer Taube bedrucken und anschließend beschriften. Die größte Diskrepanz zeigt sich für mich eigentlich in den Farben der Stifte, die sich auf Grautöne bzw. Schwarz reduzieren. Das ist mir erst später bewusst geworden. Denn natürlich würden Kinder alle Farben benutzen wollen, wenn sie solche Karten gestalten. Gleichzeitig orientiert sich das Set an der erwachsenen Lebenswirklichkeit. Das zwingt dann natürlich auch, sich mit den Grenzen unserer Bestattungskultur auseinanderzusetzen.
Viele junge Erwachsene, die die Bilder gesehen haben, fanden das befremdlich und in gewisser Form geschmacklos. Denn natürlich stößt das im ersten Moment auf und steht im Gegensatz zu dem, was wir mit Kindheit assoziieren. Im Zusammenhang mit den anderen »Lehr«-Spielzeugen hat das zu spannenden Diskussionen, zum Teil ganz intimen Gesprächen geführt.
Ganz im Gegensatz dazu stand die Reaktion von Eltern, die bereits in der Situation waren, dass sie sich mit ihren Kindern auf Grund eines Todesfalls mit dem Thema auseinandersetzen mussten. Für sie war Set ein vorstellbares Produkt. Selbstverständlich nichts, was man sich zu Weihnachten unter dem Tannenbaum vorstellt, aber auf jeden Fall ein Lehrmittel und sei es, um auf eine Beerdigung vorzubereiten.



Besonders die Ideen aus einem Workshop sind sehr spannend und interessant. Du hast dabei mit den Teilnehmern analysiert, wie man mit gesellschaftlichen Reaktionen auf Trauer umgehen kann. Z.B. gab es Ideen, einen Trauerschlips zu tragen, der Außenstehende vorwarnt oder Hörstöpsel zu benutzen, die Kommentare herausfiltern oder an die E-Mail-Signatur eine Trauersignatur zu hängen.
Was kann Design in Bezug auf Trauer leisten?
Viele Ideen, die im Workshop entstanden, verfolgen einen sehr angewandten Ansatz. Das kam sicher auch dadurch, dass die Teilnehmer nicht nur Designer waren sondern ganz unterschiedliche Hintergründe hatten. Dabei haben wir versucht für unterschiedliche Bedürfnisse, die sich aus meiner Recherche ergeben haben, Antworten zu finden. Etwa darauf, wie sich Trauernde gegen unpassende Äußerungen schützen können.
Der Trauerschlips greift dabei eigentlich etwas verlorenes auf. Denn das Tragen von schwarzer Kleidung hatte früher auch die Funktion, dass Dritte erkennen konnten, dass eine Person in Trauer ist und sie sich dementsprechend darauf einstellen. Das vermeidet in gewisser Form natürlich viele »Fettnäpfchen«. Gleichzeitig möchte heute niemand über Wochen schwarz tragen und seine Trauer zur Schau stellen. Eine kleineres Indiz wäre dabei sicher etwas dezenteres wie eben dieser spezielle Schlips.
Besonders überraschend kam für mich im selben Zusammenhang die Idee einer Trauersignatur am Ende einer eMail. Denn gerade dann, wenn ich mein Gegenüber nicht sehen und hören kann, ist es schwer solche Umstände zu erahnen. Im Gegenzug würde solch eine Signatur allerdings verlangen, offener zu der eigenen Trauer zu stehen und Außenstehenden die Chance einzuräumen, angemessen zu reagieren.
Auch die jetzigen Grenzen des Digitalen waren ein großes Thema – also die Frage wie wir zukünftig auf Distanz Trost zu spenden oder gar gemeinsam trauern könnten. Viele Überlegungen gingen dabei in die Richtung, neben den gängigen Kommunikationsmitteln dritte Objekte zu haben, durch die eine Trauergemeinschaft nonverbal in Kontakt bleiben kann. Und das auch dann, wenn sie sich an verschiedenen Orten befinden. Nähme eine Person sein Objekt in die Hand, um zu gedenken, würden auch die Objekte der restlichen Hinterbliebenen aktiviert und somit dezent erinnern. Reagiert einer darauf, indem er wiederum sein Objekt zur Hand nimmt, bekommt das der eigentliche Auslöser als Feedback kommuniziert. Ohne Worte würden hier Zwei wissen, dass sie in dem Moment nicht alleine sind. Und da reicht es zu wissen, dass es sich um ein anderes Mitglied der Trauergemeinschaft handelt. Diese Anonymität in einer bekannten Gruppe erleichtert somit auch das Einfordern von Trost. Gerade diese Ideen haben für uns heute noch etwas sehr abstraktes. Denn wie müsste so ein Objekt aussehen, damit es wirklich reine Präsenz übermittelt und sich dabei so wenig künstlich oder technisch wie möglich anfühlt. Könnte das nicht vielleicht sogar ein Stein sein und was wäre ein adäquates Feedback für einen Stein. Ein Vibrieren etwa bekommt dann natürlich etwas geisterhaftes, was in diesem Kontext sicher falsch wäre. Mit solchen Überlegungen kommt man sehr schnell ins Postdigitale und die Überlegungen, wie wir genau solche Fragen heute schon evaluieren können. Denn natürlich können zwei Steine schwer miteinander kommunizieren. Aber vielleicht braucht es auch Produkte, die sich nicht typisch digital anfühlen.
Für mich war am Ende des Workshops klar, dass Design als Disziplin nicht auf alle Fragen Antworten liefern kann. Ganz sicher gibt es Bereiche in denen schlichtweg Gestaltung gefragt ist. Etwa bei der Überlegung wie man zum Vorsorgen anregen kann oder etwa ganz neue Dienste dazu erschaffen könnte. Auch der Gedanke auf Distanz zu trösten, birgt eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, die sicher nicht nur aus entweder Vorbeifahren oder eben eine Nachricht schreiben bestehen.
Andererseits gibt es Problematiken, die wiederum nicht durch Design gelöst werden. Etwa bei der Frage wie wir mit Trauer umgehen. Das sind schlichtweg gesellschaftliche Probleme, die sich nicht von heute auf morgen ändern werden. Trotzdem denke ich, dass auch Gestaltung Fragen aufwerfen kann. Und das ist wiederum ein kleiner Anteil daran ein Umdenken anzuregen.

Über Maximilian von Elverfeldt
Max hat Interface Design an der Fachhochschule Potsdam und der Malmö Högskola in Schweden studiert und die D.School am Hasso-Plattner-Institut besucht. Seit diesem Jahr arbeitet er als Interaction Designer bei IxDS. Das Trauerset und ältere Arbeiten sind auf seiner meiner Website dokumentiert. http://max.elverfeldt.com
Alle Fotos von Maximilian von Elverfeldt. Das Interview führte Nadine Roßa