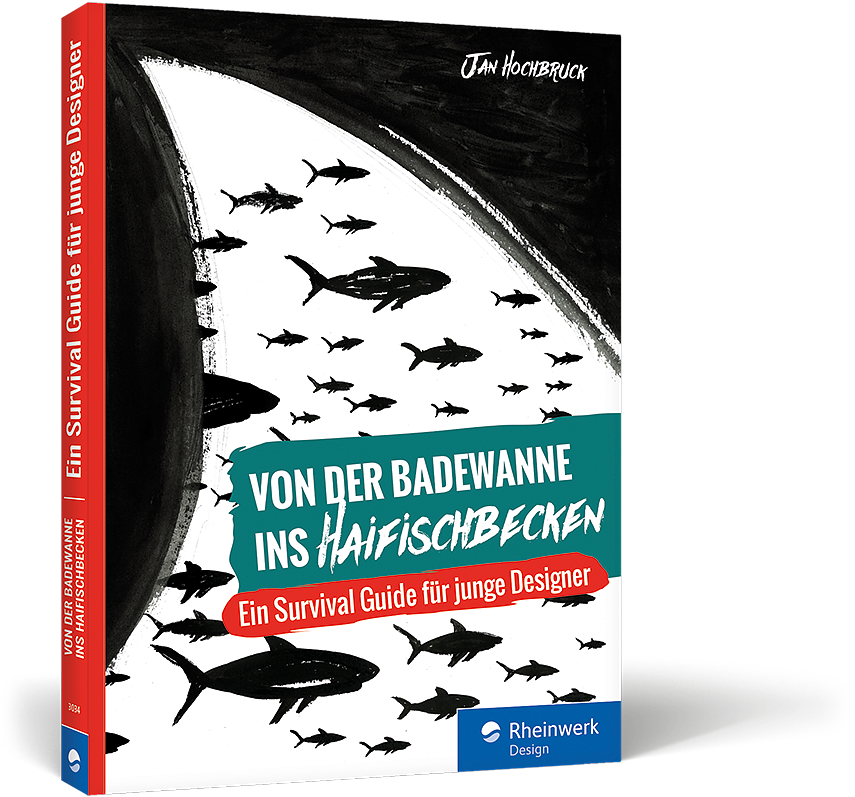Die Welt der Agenturen – Teil 2
Teil 1 Teil 2 Teil 3
Und wo bewerbe ich mich jetzt?
Die Überlegung, bei wem du dich bewerben solltest, ist in erster Linie eine strategische: Wo möchte ich hin? Das könnte ein beliebiger Ort auf einer Karriereleiter sein, kurz- oder längerfristig definiert, er hat jedoch zwei Unterdefinitionen: Was möchte ich tun? Und: Wo will ich leben?
Das Wo möchte ich hin? klingt zuallererst nach Titeln (AD, CD, ECD, CEO, MFG, ETC), nach Geld, dicken Autos und gentrifizierten Wohngegenden. Man kann das wirklich so sehen: Gutes Geld und ego-fixierende Sozialprothesen wie Statussymbole sind durchaus valide Anreize, sich karriereorientiert zu bewerben; hier sind die großen Agenturen scheinbar im Vorteil, die genau diesen Aspekt der Karriere bereits in ihrer eigenen Struktur ermöglichen. Wenn du als Junior-AD in einer Fünf-Personen-Agentur anfängst, bringst du es vielleicht dazu, irgendwann voller Art Director zu werden, aber nur, wenn die Agentur in dieser Richtung wachsen möchte. In der Hierarchie wirst du zwar oberhalb der Agenturkatze bleiben, aber auch nur bei guter Arbeit und Bewährung.
„Die anderen Aspekte – was möchte ich tun und wo möchte ich leben – mögen vielleicht zweitrangig erscheinen, haben aber eine längerfristige Strahlkraft.“
Die anderen Aspekte – was möchtest du tun und wo möchtest du leben – mögen vielleicht zweitrangig erscheinen, haben aber eine längerfristige Strahlkraft. Das Wo möchte ich leben? ist interessant: Es wird jungen Kreativen gerne unterstellt, dass sie in die großen Städte strömen wie Tschechows Schwestern (nur ja nicht in der öden, öden Provinz bleiben!). Frank Sinatra besingt New York mit If you can make it there, you’ll make it anywhere – er singt nicht darüber, wie viele es jährlich in New York nicht schaffen und zurück nach Poughkeepsie gehen müssen (wenn sie nicht gerade mit den Füßen voran rausgetragen werden). Ich kenne ein paar glückliche Leute, die sich nach dem Studium bewusst in Dörfern niedergelassen haben; sie sind lieber auf dem Dorf die integrierten, glücklichen Inhaber von Quasi-Monopolen als in der Großstadt einer von 12 000 Kreativen, die sich gegenseitig die Jobs wegnehmen und in der Szene auf die Nerven gehen.
Auch das Gründen einer Familie, Aufziehen von Kindern ist auf dem Land immer noch um einiges günstiger und weniger problembehaftet als in der Stadt. Ein übergreifendes soziales Netz lässt sich auch auf dem Land leichter einrichten, wenn man die Fähigkeit hat, sich an die Gegebenheiten anzupassen. Letzteres ist mit einiger Wahrscheinlichkeit der Grund für die Landflucht der Kreativen: Mitgliedschaft im Schützenverein und internationale Anerkennung als Gestalter klingen nicht gerade homogen. Lockender ist das Landleben für erfolgreiche Leute, die im reifen Alter die Stadt hinter sich lassen können (und denen man dann aus der Stadt heraus dauernd hinterherrennt, um ihre Entscheidungen einzuholen). David Ogilvy, der vielleicht erfolgreichste Werbetexter aller Zeiten, lebte in einem Schlösschen an der Loire. Otl Aicher, wohl einer der prägendsten Grafikdesigner Deutschland, starb im Dörfchen Rotis, als er mit seinem Aufsitzrasenmäher einen Verkehrsunfall baute.
Wahrscheinlich denkst du jedoch, am Anfang der Karriere ist das Wo erst einmal zweitrangig – und im Zweifelsfall ist das reine Angebot an Jobs, Zeitgeist und Leben in großen Städten um einiges reichhaltiger als auf dem Land. Dahin kannst du später immer noch ziehen, denkst du. Gut, reden wir später darüber.
Wichtiger als das Wo ist zuerst einmal das Was. Nehmen wir einmal an, du hast schon die Entscheidung gefällt, dich als Art Director oder Designer zu etablieren: Gibt es etwas, was du innerhalb der jeweiligen Bereiche besonders gerne tust und von dem man dir sagt, dass du es besonders gut machst?
„Du solltest dein Geld mit dem verdienen, was du besonders gerne machst. Ansonsten kann es dir passieren, dass du Unzufriedenheit anlagerst wie ein Vielfraß die Speckpolster.“
Wenn du diese beiden Punkte nicht in Übereinstimmung bringen kannst, hast du ein Problem (ich meine in diesem Fall natürlich nicht, ob die Leute zum Beispiel deine Caipirinhas besonders schätzen oder Fans davon sind, wie gut du Bill Murrays Synchronstimme imitierst; es geht schon um den professionellen Output). Du solltest dein Geld mit dem verdienen, was du besonders gerne machst. Ansonsten kann es dir passieren, dass du Unzufriedenheit anlagerst wie ein Vielfraß die Speckpolster. Unzufriedenheit zu überwinden ist ein erstaunlich langwieriger und anstrengender Prozess, je tiefer du dich in die Missstände eingegraben hast, desto schwieriger wird es, wieder herauszukommen.
Eine wie auch immer geartete Spezialisierung bestimmt zu großen Teilen mit, wo du überhaupt arbeiten kannst (womit sich das Wo schon wieder fast erledigt). Egal, wo David Ogilvy und Otl Aicher am Ende ihrer Karriere lebten, der Berufseinsteiger ist dort am besten aufgehoben, wo die Nachfrage nach seinen Diensten ausreicht; je spezialisierter, desto seltener, aber intensiver ist die Nachfrage. Auf Barockfrisuren spezialisierte Stylisten sind nicht wirklich Tag und Nacht ausgebucht, sind aber, wenn sie gebucht werden, Tag und Nacht aktiv. Wer als Freelancer für jeden Job einen ganzen Reisetag einplanen muss, sollte entweder von wenigen Jobs problemlos leben können oder über einen Umzug in infrastrukturell besser geeignete Gegenden nachdenken. Für einen Nichtfreelancer gilt das erst recht: Wer sich zum Beispiel auf Editorial Design spezialisiert hat (oder unbedingt in diese Sparte rein möchte), ist einfach am besten in den Großstädten aufgehoben, in denen große Verlagshäuser ihre Sitze haben. Oder in Gütersloh.
Freelancertum als Einstieg
Eine hohe Spezialisierung – oder eine sehr vorteilhafte Arbeitsmarktlage – kann es dir erlauben, als Freelancer ins Berufsleben einzusteigen. Das hat deutliche Vorteile: mehr Abwechslung, mehr Geld, freie Einteilung der eigenen Arbeitszeit. Die Agenturen sind wild nach deinen wie aus dem Ärmel geschüttelten Layouts, sie balgen sich um deine Animationen, du hast Anfragen für die nächsten zwei Jahre. Du jettest zwischen Paris, Berlin und London hin und her. Das Leben ist schön.
„Viele freiberufliche Designer sitzen bei einem einzelnen Auftraggeber herum, oft über eine Zeitarbeitsfirma vermietet, um der Schein- selbständigkeitsregelung zu entgehen.“
Wenn das nur so stimmen würde. Für einige ist es sicherlich so wie oben beschrieben, aber längst nicht für alle. Viele freiberufliche Designer sitzen bei einem einzelnen Auftraggeber herum, oft über eine Zeitarbeitsfirma vermietet, um der Scheinselbständigkeitsregelung zu entgehen; das Einzige, was sie von den festangestellten Kollegen unterscheidet, ist ihre beinahe minütliche Kündbarkeit. Sie werden kurzfristig angefragt und gebucht, wenn in der Agentur jemand ausgefallen ist, auch gerne als Ausputzer, wenn mal wieder mit Briefing etc. getrödelt wurde und nur noch drei Tage bis zur Abgabe einer umfangreichen Pitchpräsentation übrig bleiben. Sind sie in dieser Situation ausgelastet und können keine zusätzliche Arbeit annehmen, droht die Agentur mit Boykott, Liebesentzug, Verlust zukünftiger Jobs. Manchmal kriegen sie einen Job, der mit Malen nach Zahlen gut beschrieben wäre, wären da nicht die Widersprüche in den Farbangaben, die das Ganze in eine unappetitliche Matsche verwandeln – wenn sie es dann so machen wie gewünscht, werden sie beschimpft, wenn nicht, auch. Die Auftraggeber versuchen, sie mit Bezahlung bei Erfolg und sehr weitreichenden Interpretationen eines Achtstundentages hereinzulegen. Das Leben ist schrecklich.
„Gerade zu Beginn deiner Karriere musst du dir zum vielen Arbeiten auch noch viel Sorge um dich selbst aufpacken.“
Aber was noch schlimmer ist: Du lernst nichts. Als hochtalentierte, spezialisierte Freelance-Kraft bist du der Propellerhead, der eingesetzt wird wie eine Sonnenbrille: kurzfristig, wenn Bedarf dafür da ist, und um schick dazustehen. Die Agenturen haben kein Interesse daran, sich um deine berufliche oder menschliche Weiterentwicklung zu kümmern; das ist alles in deinem Lohn enthalten. Natürlich kannst (und wirst) du mit der Zeit eigene Strukturen aufbauen können, die hier vollwertigen Ersatz leisten. Gerade zu Beginn deiner Karriere bedeutet es aber, dass du dir zum vielen Arbeiten auch noch viel Sorge um dich selbst aufpacken musst, die gerne beim Berufseinstieg vernachlässigt wird. Ich will auch nicht behaupten, dass Agenturen hauptgeschäftlich Nachwuchsförderung betreiben. Aber es ist in ihrem Interesse, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in dir zu fördern. Die Bedeutung der Nachwuchsförderung ist in den letzten Jahren wieder etwas gestiegen, nachdem die nuller Jahre fast ausschließlich der Digital Bohème gewidmet waren: Möglichst frühzeitiges Einzelkämpfertum, digitale Vernetzung und emsiges Nischenbesetzen führten zu einer Generation von Einzelkindern, die es heute schwer hat, in einem Team große, kohärente Projekte zu stemmen. Spontane gute Zusammenarbeit von Einzelkämpfern findet man nur im Kino, in der Realität brauchen sie eine Menge Kennenlernen, gemeinsames Training, Aufeinander-Einstellen, um gemeinsam einen guten Job zu machen.
Agentur oder Firma?
Das ist eine der wirklich lebensentscheidenden Fragen der Kreativbranche. Sie betrifft vor allem Designer, denn Werbemenschen können meist gar nicht beim Kunden arbeiten (diese Formulierung enthält schon den Widerspruch in sich: Natürlich wäre in diesem Falle der Kunde nicht mehr Kunde, sondern Arbeitgeber, den meisten Werbern sitzt aber das Rollenverhältnis so tief in den Knochen, dass sie diese leicht absurde Formulierung beibehalten). Es gibt gar nicht so viele Positionen für kreative Werbemenschen beim Kunden. Die Zeiten der großen firmeninternen Werbeabteilungen sind schon lange vorbei: Auf Seiten des Kunden gibt es zwar eigene Marketingabteilungen, die mit den Werbeagenturen Kontakt halten, das kreative Schwitzen selbst wird aber meistens outgesourct und damit billiger und schneller eingekauft. Das ist auch besser so – die Einöde des Immer-für-denselben-Kunden-Arbeitens bringt jeden kreativen Werbemenschen effektiver um als jede Form der Überarbeitung (Kundenberater und Projektleiter haben es da etwas besser und können durch den Wechsel zum Kunden ihren alten Laden ganz schön in Angst und Schrecken versetzen, wenn sie auf einmal mit ihrem ganzen Agentur-Insiderwissen dort auf der anderen Seite des Tisches sitzen – das ist übrigens auch ein dringender Anreiz, mit allen, aber auch allen Menschen fair und freundlich umzugehen).
„Die Einöde des Immer-für-denselben-Kunden-Arbeitens bringt jeden kreativen Werbemenschen effektiver um als jede Form der Überarbeitung.“
Ganz anders sieht es mit Designabteilungen aus. Natürlich können es sich auch nur große Unternehmen leisten, eine eigene Abteilung voller spezialisierter Designer fest zu beschäftigen, die sich um die Nutzbarkeit und Gestaltung ihrer Produkte kümmert. Von diesen Unternehmen gibt es aber trotzdem eine erstaunliche Menge – und dazu kommt eine große Menge kleinerer und mittlerer Firmen, die sich mit virtuellen Produkten befassen und deren Designer die Interfaces dieser Produkte gestalten.
Und natürlich gibt es auch im Bereich Produktdesign (wo profunde Kenntnisse der Marke zwingend notwendig sind) freiberufliche Studios, die so gut wie alles machen und von großen Unternehmen gebucht werden, wenn es darum geht, neue Impulse ins eigene Geschäft zu bringen oder einfach nur eine Edition auf den Markt zu werfen, die sich (und die Marke) mal demonstrativ mit dem Namen des Designers schmückt. Automarken inszenieren sich gern mal mit einem extravaganten Flitzer aus der Hand eines italienischen Stardesigners, sehr zur Motivation der eigenen festen Automobildesigner, die bei jedem kühnen Wurf meist so weit zurückgepfiffen werden, bis hinterher doch wieder alle Autos aussehen wie Kühlschränke mit Scheinwerfern. Trotzdem sind diese Allrounder-Designagenturen selten und haben auch in ihren eigenen Reihen Spezialisten für die verschiedensten Bereiche.
Meistens bleiben Designagenturen – auch freie – spezialisiert auf eine relativ präzise umrissene Branche wie Produktdesign, Automobildesign, Editorial- oder App-Interface-Design (mit jeder Möglichkeit zur Subspezialisierung auf Ausstellungskataloggestaltung, Motorraddesign oder zum Beispiel Android-Apps).
Es kommt vor, dass der Hype um einzelne angesagte Designer – Philippe Starck zum Beispiel oder Meiré und Meiré – diese dazu drängt, sich aus ihrem eigentlichen Spezialgebiet herauszutrauen und fremde Bereiche zu übernehmen; die außergewöhnlichen Arbeiten von Meiré und Meiré führten zum Beispiel in den frühen 90ern zu einer kurzen Welle von Werbeaufträgen. Meistens legt sich dieses Wildern in fremden Revieren allerdings wieder, entweder wenn sich herausstellt, dass diese Art zu arbeiten nicht das Ding der Designer ist, oder wenn der Kunde von den Resultaten enttäuscht ist. Oder beides.
„Für den Beruf eines Designers braucht man sehr viel mehr Sitzfleisch und Geduld als für den Job des Werbers.“
Das Unterkommen in der großen Designabteilung eines Unternehmens bietet neben den Vorteilen eines geregelten Gehalts und Sozialleistungen die Möglichkeit, weiter zu lernen und Arbeitserfahrungen zu sammeln, die du in dieser Art nicht an der Hochschule bekommen kannst – und die auch im Praktikum nur unzureichend rüberkommen. Ich habe im ersten Kapitel erwähnt, dass Design ein langsamerer, subtilerer, kleinere-Schritte-machender Prozess ist als Werbung; die Arbeit an einem neuen Auto dauert schon mal zehn Jahre. Für den Beruf eines Designers brauchst du sehr viel mehr Sitzfleisch und Geduld als für den Job des Werbers – nicht zuletzt bedingt durch die nur langsam ansteigende künstlerische Lernkurve: Während der Art Director sich im Zweifelsfall die Spezialisten ins Boot holt, die den Spezialauftrag nach seinen Maßgaben erledigen, ist der Designer selbst Spezialist und dem dauernden Training, das seine Kunst erfordert, unterworfen.
Interfacedesign ist schneller, kurzlebiger und rabiater als das relativ langsame Produktdesign. Das liegt in erster Linie am rasanten technischen Fortschritt. Der überschüttet dich und deine eigenen Ideen mit Unmengen sinnloser und sinnvoller Features, die jeden Tag entwickelt werden. Deine Aufgabe ist es nicht nur, diese Features auszuwerten, in Sinn zu verwandeln und nutzbar zu machen, sondern (ganz abgehoben von der Technik) den Nutzer und sein Anliegen in den Mittelpunkt zu stellen.
Features hin oder her, wenn sie dem Nutzer keinen Lust- oder Leistungsgewinn bringen, bringen sie nichts. Für Interfacedesigner ist deshalb keine langsam ansteigende Lernkurve, kein längeres Padawan-Dasein unter der Ägide wachsamer und fürsorglicher Yodas drin – schon deshalb, weil die Branche selbst so jung ist, dass noch keiner – selbst der ältesten Füchse – das Rentenalter erreicht hat.
„Etwas Neues wirkt immer gleich cool und begehrenswert, auch wenn es absehbar ist, dass man das Feature nicht nutzen kann“
Der Wert der Innovation hat etwas Selbstläuferhaftes im Interfacedesign. Ein wie auch immer gearteter Durchbruch neuer Nutzungsmöglichkeiten schwebt jedem vor – letztlich kann man aber eine relativ deutliche Linie ziehen zwischen den neuen Tricks, die man gerne lernt, weil sie eine Verbesserung bedeuten (zum Beispiel Tastenfeld gegenüber Wählscheibe am Telefon – auch wenn es eine Menge virtueller Wählscheiben für Smartphones in den App-Stores gibt) und den neuen Tricks, die blöde sind und nicht akzeptiert werden (zum Beispiel die Gesten-Balanceakte, die den Umgang mit Samsung-Handys Anfang der 2010er Jahre kompliziert machten, bis User entdeckten, wo sie sie in den Einstellungen ausschalten konnten).
Etwas Neues wirkt immer gleich cool und begehrenswert, auch wenn es absehbar ist, dass man das Feature nicht nutzen kann, ohne dass das Smartphone jede kleinste Regung von dir falsch interpretiert und fröhliche Gruppenchats aus deiner Hosentasche in die Wege leitet. Die Psychologie hinter diesen Hypes ist ähnlich wie die bei den Blasen in der Wirtschaft: Alle machen es, weil alle es machen, auch wenn alle einsehen, dass es nicht ewig so weitergehen kann. Es kann dir sogar passieren, dass du aus der Chefetage eins auf den Deckel bekommst, weil du nicht gleich der nächsten durchs Dorf getriebenen Sau hinterherrennst. Für den ernsthaft am eigenen und am Fortschritt der Menschheit interessierten Designer ist es zwar unerlässlich, die Anzahl, Größe und Laufstrecke der Säue durchs Dorf im Blick zu behalten und eine stetige Auswertung der Laufcharakteristika zu betreiben, das Hinterherrennen lohnt sich aber nur bei einzelnen, wirklich wichtigen Säuen.
„Alle machen es, weil alle es machen, auch wenn alle einsehen, dass es nicht ewig so weitergehen kann.“
Jobs für Interfacedesigner gibt es viele, und sie sind so gut wie alle urban. Kleine und große Internet- und Mobile-Dienstleister, Softwareschmieden, whatever: Jeder braucht Menschen, die bereit und fähig sind, für sie Interfaces zu gestalten, damit ihre Apps und Sites abheben – dieser Mensch könntest du sein. Schließlich bist du jung und hast Lust, Projekte zum Fliegen zu bringen. Die Wahl zwischen groß, mittel und klein stellt sich hier genauso wie bei den Werbern, und in gewisser Weise sind auch die Verhältnisse ähnlich. Es gibt jedoch den Unterschied, dass bei kreativen Start-ups die Chance besteht, dass der ganze Laden mit Produkt, Idee und Inventar verkauft wird: Die Geschäftsidee dieser kleinen Kreativschmieden ist häufig nicht mehr, mit ihrer Idee erfolgreich zu sein, einen Markt zu erobern, ihn umzuwälzen oder gar neu zu schaffen, sondern mit Mann und Maus an einen größeren Wettbewerber oder einen großen Systemanbieter zu verkaufen. Die Nachrichten sind voll von Verkaufsmeldungen großer und kleiner Start-ups zu teilweise bestürzenden Preisen. Es ist vollkommen verständlich, dass dieses Geschäftsmodell für kreative Leute verlockender ist als eine mühevolle Aufbauarbeit, die Jahre dauert und dann eventuell doch einfach an der besseren Vernetzung des Konkurrenten scheitert. Du solltest nur zusehen, dass du bei einem solchen Deal zu den beteiligten Gewinnern gehörst und nicht zum verkauften Inventar.
Kleine Designagenturen und -studios sind häufig kreativer als große, weshalb große Unternehmen, durch ihre eigenen quälerisch langsamen Prozesse und Entscheidungswege gehemmt, sie mit eiligen oder besonderes kreatives Augenmerk erfordernden Jobs beauftragen und so trotzdem schnell liefern können. Gerade Prototypen von Apps werden gerne outgesourct – viele kleine Designagenturen leben so symbiotisch mit den großen Unternehmen zusammen, ohne eine eigene millionen- oder milliardenschwere Idee zu verkaufen. Diese Symbiose ist nicht immer leicht (wenn der Riese einen Schnupfen hat, bekommt der Zwerg Fieber), aber sie kann einem Designer ein gutes Leben verschaffen, das nicht die tödliche Mischung aus bräsiger Langeweile und grausamer Hektik beinhaltet, die man in großen Unternehmen so oft antrifft.
Ähnlich wie in der Werbung kannst du auch als Designer davon ausgehen, dass sich das Einstiegsgehalt so gut wie überall auf dem Niveau schlechter Witz/nacktes Überleben bewegt: Wenn du in einem großen Laden anfängst, ist das die subtile Art und Weise, in der man dich an deinen Rang erinnert; wenn du mit einem Start-up beginnst, ist oft einfach kein Geld in der Kasse. In Werbung und Design zehren die Arbeitgeber gerne vom Enthusiasmus ihrer (jungen) Angestellten, mitunter fressen sie sie sogar ganz auf. Achte deshalb besonders auf Arbeitgeber-Bewertungen, und höre dich auch bei deinen Freunden und Kollegen um, was hinter dem tollen Namen oder Angebot stehen könnte.
Falls es dir immer noch schwerfällt, dich für die richtige Agentur (Firma, Studio, egal) zu entscheiden: Mache es wie Gandalf in der Der Herr der
Ringe-Verfilmung, und vertraue deiner Nase. Du musst dich an den Geruch in deiner neuen Arbeitsstätte gewöhnen können, das klappt sicher nicht, wenn es dir dort bereits beim Einstellungsgespräch stinkt. Und noch etwas: Es ist durchaus nicht unwichtig, wie weit dieser Ort von deiner Wohnung entfernt liegt und welche Möglichkeiten zum Hinkommen, Einkaufen, Essen, Entspannen und Wieder-Wegkommen dort geboten sind. Natürlich kann es sich lohnen, für einen richtig guten Arbeitgeber Pendelwege von ca. 200 km täglich auf sich zu nehmen, aber für Berufseinsteiger ist das nicht nur mörderisch (das ist es auch für Erfahrenere), es ist auch nicht zu finanzieren.
Teil 1 Teil 2 Teil 3
Leseprobe aus dem
Survival Guide für junge Designer
Von Jan Hochbruck
Inhalt
- Vom Praktikum zum Junior Art Director
- Der erste Job – das erste Jahr
- Eigene Projekte haben – und durchziehen!
- Karriere oder Hamsterrad?
- Hierarchien, Strukturen und Trampelpfade
- Richtiges Geld für richtige Arbeit
- Life-Work-Balance
- Gibt es ein kreatives Leben jenseits der 35?
Preis
Buch
24,90 Euro
E-Book
19,90 Euro
Versand
Kostenlos für Deutschland und Österreich
Weblog
Die Top 5 Vorteile einer Social Media Werbeagentur buchen
Die Qual der Wahl – Erfolg im Internet – die Auswahl der Webagentur
E-Mail-Outreach betreiben: Die besten Tipps, um effektiv Entscheider zu erreichen
Festplatte abgestürzt – das sind die 3 häufigsten Gründe!
Werbebotschaften – der Motor für den Verkauf
Webdesign – was müssen Unternehmen beachten?
Welche Werbe- und Designtrends sind für 2024 zu erwarten?
Limitierte Editionen: Das Phänomen von exklusiven Sneaker-Veröffentlichungen
To-go-Verpackungen mit Persönlichkeit
Die Vorteile eines eigenen Website-Servers: Das sind sie
Den Ort finden, an dem Kreativität am besten entsteht
Wie Design unser Leben beeinflusst
Die Macht der Farben: Farbpsychologie im Webdesign